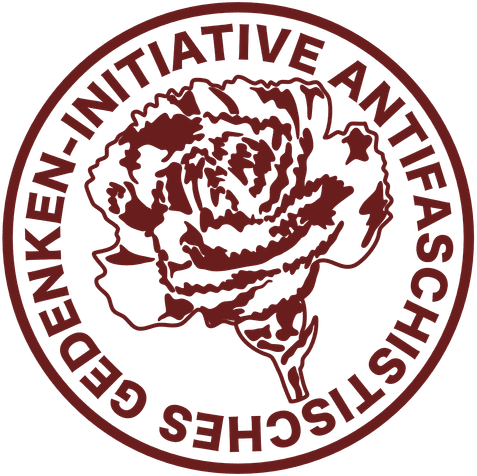Im Dezember 1993 begann in Österreich die erste Serie des rechtsextremen Bombenterrors der „Bajuwarischen Befreiungsarmee“. In unseren Beiträgen der letzten Monate, haben wir die ersten 10 Adressat*innen der Briefbomben kurz porträtiert und einige Hintergründe zu den einzelnen Anschlägen zusammengetragen. Wir möchten nun abschließend versuchen, die Serie I politisch einzuordnen.
Die Adressat*innen waren nicht zufällig ausgewählt
Die ersten zehn Briefbomben der BBA waren gerichtet an Personen, die in der Öffentlichkeit standen und an öffentliche Organisationen/Vereine. August Janisch und Helmut Schüller waren bekannt für ihre Arbeit im Geflüchtetenbereich und wurden deshalb zur Zielscheibe. Silvana Meixner ist Kroatin und baute die ORF-Minderheitenredaktion mit auf, sie war Moderatorin der Sendung „Heimat Fremde Heimat“ und engagierte sich in ihrer Arbeit als Journalistin für Minderheiten, Geflüchtete und gegen Rassismus.
Helmut Zilk wurde als besonders weltoffener Wiener Bürgermeister wahrgenommen, etwa aufgrund seines Engagements für die jüdische Bevölkerung und Kultur in Wien.
Madeleine Petrovic war Bundessprecherin der Grünen, stand also ebenso für progressive und „ausländerfreundliche“ Politik und war nicht zuletzt eine verhältnismäßig junge, weibliche Politikerin. Auch Terezija Stoisits war 1993 eine relativ junge Frau, die damals bereits drei Jahre grüne Nationalrats Abgeordnete war. Außerdem ist sie Burgenlandkroatin aus Stinatz. Diese kleine, mehrheitlich burgenlandkroatische Gemeinde wurde nicht nur in mehreren Bekennerbriefen der BBA explizit erwähnt – 1995 legten die Rechtsterroristen dort eine Rohrbombe. Wolfgang Gombocz war Obmann des slowenischen Kulturvereins in Bad Radkersburg (Südsteiermark) und wurde ebenfalls aufgrund seiner Minderheitenangehörigkeit und seines Engagements zum Ziel.
Johanna Dohnal ist wahrscheinlich die bekannteste und einflussreichste österreichischen Feministin des 20. Jahrhunderts. Als erste Frauenministerin des Landes gelangen ihr riesige Fortschritte vor allem im Familien- und im Sexualstrafrecht. Mit dem Rechtsruck der frühen 1990er Jahre geriet sie immer stärker ins Kreuzfeuer rechter und antifeministischer Agitationen.
Die letzten beiden Briefbomben wurden an den „Islamischen Ausländer-Hilfsverein“ und die „ARGE Ausländerbeschäftigung“ der Wirtschaftskammer
geschickt.
Das Motiv der Terroristen war ein politisches, das zeigt sich schon an der Auswahl der Adressat*innen ganz deutlich. Und auch die Bekennerbriefe der BBA sind geprägt von extremer Minderheitenfeindlichkeit und Rassismus, von Antisemitismus und einem patriarchalen, misogynen Weltbild.
Der politische Kontext
Die 1990er Jahre waren von einer rassistischen Stimmungsmache geprägt. Die FPÖ entwickelte sich unter ihrem damaligen Obmann Jörg Haider rasant in Richtung rechten Rand und mit dem „Österreich-Zuerst- Volksbegehren“ verließen auch die letzten halbwegs liberalen Mitglieder die Partei und die FPÖ wurde zu dem, was sie heute ist: eine rechtsextreme Partei. Mit dieser öffentlichen Radikalisierung der FPÖ wurden auf einmal Dinge sagbar gemacht, die seit 1945 zumindest nur hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen werden konnten: Rassistische, antiziganistische und antisemitische Einstellungen
konnten wieder offen geäußert werden. Und eine Gesellschaft, in der solche Einstellungen toleriert und schlussendlich belohnt werden, macht sich mitverantwortlich für die gewaltvollen Taten, die auf die verbale Hetze folgen – Der BBA-Terror ist ohne die vorangegangene rassistische Hetze der FPÖ und ihrer Gesinnungskameraden nicht denkbar.
Auch, wenn sein zutiefst politischer Charakter in der Debatte über den BBA-Terror meistens ignoriert wird: es handelt sich hier um eine politische Terrorkampagne, die klare inhaltliche Verschränkungen mit der österreichischen Neonaziszene aufweist und sich eindeutig auf rechtsextreme Ideologie bezieht. Das zeigt sich bereits in der ersten Serie.
Bereits den Briefen der ersten Serie waren kurze Schreiben beigelegt, unterzeichnet von Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg. Starhemberg leitete die Verteidigung Wiens während der Zweiten Türkenbelagerung 1683. Bezüge österreichischer Rechtsextremer auf die Verteidigung gegen „die Türken“ (und insbesondere auf die Figur Starhemberg) sind überaus typisch.
Im Jahr 1992 wurde in der NPD-nahen Zeitschrift „Vorderste Front“ dazu aufgerufen, in den militanten Untergrund zu gehen und die „Bajuwarische Einheit“ wiederherzustellen – dieser Aufruf steht im direkten Zusammenhang mit der Verschärfung des Verbotsgesetzes, mit der Auflösung der Wehrsportgruppe Trenck und mit den Gerichtsprozessen gegen den Neonazi Gottfried Küssel samt Gefolgschaft, der im Jänner 1992 begonnen hatte. Ende September 1993 wurde Gottfried Küssel erstinstanzlich wegen Widerbetätigung zu zehn Jahren Haft verurteilt. Was folgte, war eine internationale Welle neonazistischer Solidaritätsbekundungen, Gewaltaufrufe inklusive. In der folgenden Ausgabe der Monatszeitung der rechtsextremen „Hilfsgemeinschaft für nationale politische Gefangene“ wurde dazu aufgerufen, 10 Briefe für 10 Jahre zu versenden. Im Dezember 1993 verschickte die „Bajuwarische Befreiungsarmee “ zehn Briefbomben.
Die ersten zehn Bomben waren leider nur der Anfang, es folgten weitere Brief- und Rohrbomben. Seinen traurigen Höhepunkt fand der Terror im Mord an Josef Simon, Erwin Horvath, Peter Sarközi und Karl Horvath. In den kommenden Monaten werden wir auf die Betroffenen der weiteren Anschläge eingehen und weiter nach Wegen antifaschistischen Gedenkens suchen.
Gegen das Vergessen!