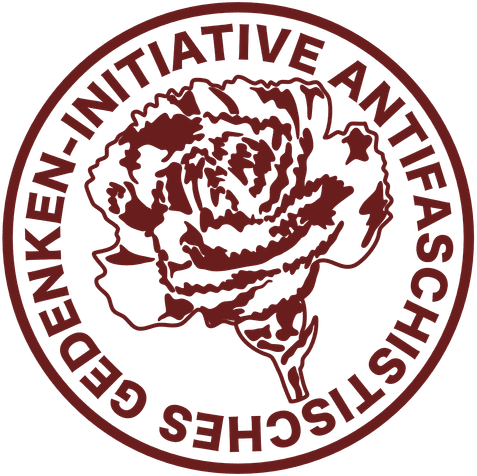Bild: Johann Jaritz via Wikimedia Commons
Vor 31 Jahren, am 24. August 1994, wurde vor der Dr. Karl Renner Schule in Klagenfurt/Celovec eine Rohrbombe deponiert. Es war die erste von drei Rohrbomben, die die selbsternannte „Bajuwarische Befreiuungsarmee“ gebaut und gelegt hatte.
Das betroffene Gebäude beherbergt die öffentliche zweisprachige Volksschule / Javna dvojezična ljudska šola.
Bereits seit 1983 kämpften Aktivist*innen und Eltern für eine zweisprachige Schule in Klagenfurt/Celovec. Nach erfolglosen Gesprächen mit der Landespolitik, sowie Sitz- und Hungerstreiks, konnte die Gründung der Schule 1989 mit Hilfe des Verfassungsgerichtshofs durchgesetzt werden. 1991 wurde die Volksschule 24/Ljudska šola 24 in der Ebentaler Straße eröffnet – 17 Kinder besuchten im ersten Jahr den zweisprachigen Unterricht, mittlerweile sind es rund 115 Schüler*innen. Seit 2003/04 werden die Unterrichtssprachen Slowenisch und Deutsch wöchentlich gewechselt.
Nur wenige Jahre nach ihrer Eröffnung wurde im Sommer 1994 eine Rohrbombe vor dem Schulgebäude abgelegt. Nachdem sie entdeckt wurde, brachten Einsatzkräfte den Sprengsatz zur Untersuchung zum Klagenfurter Flughafen, wo sie detonierte. Der Polizist Theodor Kelz verlor bei der Explosion beide Unterarme, zwei seiner Kollegen wurden ebenfalls verletzt. Das öffentliche und mediale Interesse galt vor allem Kelz – Das eigentliche Ziel des Anschlags, die zweisprachige Schule, ihre Schüler*innen und das Lehrpersonal, traten in der Hintergrund. Auch Jahrzehnte später befassen sich Presseartikel vorrangig mit Kelz und der spektakulären Transplantation, die es ihm ermögliche, „neue“ Hände zu bekommen, statt (auch) den Perspektiven der betroffenen Kärtnerslowen*innen Raum zu geben.
Der Rohrbombenanschlag war ein gewaltsamer Angriff auf die kärntnerslowenische Minderheit und das Konzept einer solidarischen Pädagogik. Er reihte sich ein in eine antislowenische, rassistische Kontinuität in Kärnten/Koroška und ganz Österreich.
Ab Ende des 19. Jahrhunderts war die slowenischsprachige Bevölkerung Kärntens einer aggressiven Assimilierungspolitik ausgesetzt, nach der Volksabstimmung 1920 verschlimmerte sich die politische Situation für die slowenischsprachige Bevölkerung noch weiter. Dies betraf ganz besonders das kärntnerslowenische Schulwesen, das von einer massiven Germanisierungspolitik betroffen war.
In der Zeit des Nationalsozialismus gipfelte der antislowenische Rassismus in Verfolgung, Umsiedlung, Deportation und Mord. Das Sprechen der slowenischen Sprache war strengstens verboten. Viele Kärntnerslowen*innen kämpften gegen die Nationalsozialisten und organisierten sich im Partisan*innenwiderstand.
Die antislowenische Gewalt endete auch nach 1945 nicht. 1972 erreichte der Konflikt um zweisprachige Ortstafeln in Kärnten/Koroška in pogromähnlichen Aktionen, die als „Ortstafelsturm“ bekannt sind, seinen Höhepunkt. Es kam zur gewaltsamen Demonatge zweisprachiger Ortstafeln, zu Bombendrohungen und zur Schändung von Partisan*innendenkmälern.
2025 wird der Lern- und Gedenkort Peršmanhof, ein zentraler Ort für kärntnerslowenische Erinnernungskultur, und das dort stattfindende antifaschistische Bildungscamp, von der Polizei angegriffen. Die Beamten gingen unter Zuhilfenahme von Polizeihubschrauber und Hundestaffel aggressiv vor und nahmen eine Hausdurchsuchung und teilweise brutale Identitätsfeststellungen vor. 80 Jahre zuvor verübten Angehörige des SS- und Polizeiregiments 13 am selben Ort ein Massaker an elf Familienangehörigen der Familie Sadovnik und Kogoj.
Die BBA äußerte in ihren Bekennerbriefen extreme, antislawisch-rassistische und insbesondere antislowenische Fantasien. In verschwörungsideologischer Manier wurde Österreich als „Tschuschendiktatur“ bezeichnet und unter anderem behauptet, anerkannte Minderheiten würden in Österreich gegenüber der Mehrheitsbevölkerung ungerechte Vorteile erhalten.
Die Kontinuität des antislowenischen Rassismus in Kärnten/Koroška und in ganz Österreich zeigt die Notwendigkeit einer solidarischen Gedenkkultur. Diese sollte die Perspektiven der Betroffenen in den Mittelpunkt stellen und sich mit ihren Anliegen solidarisieren.