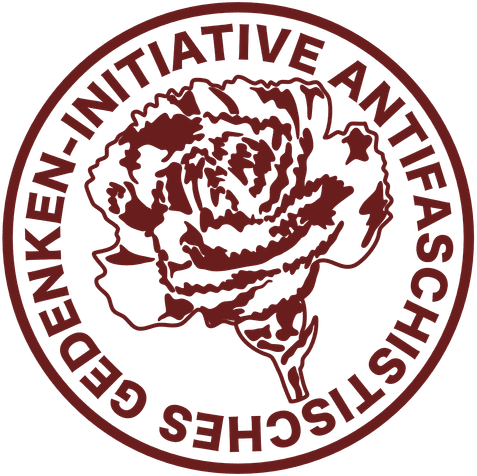Dieser Text bietet eine Einführung in die Thematik. Er ist als Grundlage für den IAG-Workshop „Antifaschistische Gedenkpraxen etablieren“ entstanden und auch als Kurz-Broschüre zum Download verfügbar.
Rechtsextremer Bombenterror 1993-1996 in Österreich
War da was?
Zwischen 1993 und 1996 wurden in Österreich 25 Briefbomben von mindestens einem Rechtsterroristen versendet. Die Adressat*innen waren divers: Minderheitenangehörige, Aktivist*innen gegen Rassismus, humanistisch motivierte Pfarrer, Politiker*innen, Reporterinnen, und einfach Menschen, die aufgrund rassistischer Zuschreibungen zur Zielscheibe wurden. Die Briefbomben verletzten 15 Menschen, teilweise schwer.
In den Jahren 1994 und 1995 wurden außerdem drei Rohrbombenanschläge verübt:
Im Spätsommer 1994 wird eine Bombe vor die kärntner-slowenische Volksschule in Klagenfurt/Celovec gelegt. Beim Versuch sie zu entschärfen, verliert der Polizist Theodor Kelz beide Unterarme.
In der Nacht von 4. auf 5. Februar 1995 werden die vier Roma Erwin und Karl Horvath, Peter Sarközi und Josef Simon im burgenländischen Oberwart durch eine Rohrbombe ermordet.
Am 6. Februar 1995 wird der Müllarbeiter Erich Preiszler im burgenlandkroatischen Stinatz durch eine baugleiche Bombe schwer verletzt. Er verliert die rechte Hand. [1]
Bekennerschreiben und „Bajuwarische Befreiungsarmee“
Bereits den Briefen der ersten Serie waren kurze Schreiben beigelegt, unterzeichnet von „Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg“. Starhemberg leitete die Verteidigung Wiens während der Zweiten Türkenbelagerung 1683. Dass der 1993 keine Briefbomben versenden konnte, ist klar. Es handelt sich hier aber um kein zufällig gewähltes Alias: Bezüge österreichischer Rechtsextremer auf die Verteidigung der Hauptstadt gegen „die Türken“ (und insbesondere auf die Figur Starhemberg) sind überaus typisch.
Etwa zwei Wochen nachdem die ersten Briefbomben explodiert waren, verschickten die Terroristen ein mehrseitiges Bekennerschreiben – wieder unter dem Namen Starhembergs. In den nächsten Jahren wurden zahlreiche weitere Schreiben verschickt, fortan unterzeichnet von der sogenannten „Bajuwarischen Befreiungsarmee“ (BBA). Die Bekennerschreiben beziehen sich klar auf rechtsextreme und neonazistische Ideologie, es werden einschlägige Slogans und Begriffe verwendet, auch der Name der BBA scheint inspiriert zu sein von einem Artikel in der NPD-nahen Zeitschrift „Vorderste Front“ aus dem Jahr 1992, in welchem dazu aufgerufen wurde, die „Bajuwarische Einheit“ wiederherzustellen. Die Schreiben sind voll von Rassismus und Fantasien über „Umvolkung“ und angeblich herrschendem „Panslawismus“. Sie enthalten Gewaltaufrufe gegenüber der sogenannten „Tschuschen-Diktatur“ (so wird Österreich bezeichnet, da zu viele Politiker*innen slawisch klingende Nachnamen hätten) und Solidaritätserklärungen gegenüber Neonazis. Die Schreiben argumentieren einer deutschnationalen und ethnopluralistischen Logik folgend. Antisemitische Aussagen sind ebenfalls zu finden, zentral sind aber vor allem antislawische Verschwörungsideen.
Einzeltäterthese, Verhaftung
Im Oktober 1997 wird der rechtsextreme F. bei einer Polizeikontrolle als vermeintlicher Einzeltäter geschnappt. Die Behörden gehen also davon aus, dass er alleine gehandelt hat – bis heute gibt es von unterschiedlichen Seiten erhebliche Zweifel an dieser Einzeltäter-these. Unter anderem ist völlig unklar, wie es möglich war, dass der verurteilte Täter die Sprengsätze, die in den Bomben verwendet wurden, allein in seiner Privatwohnung gebaut hat – ohne Ausbildung oder professionelle Laborausrüstung. Außerdem wird es als relativ unwahrscheinlich betrachtet, dass die Bekennerschreiben in dieser Wohnung und von nur einer Person verfasst wurden. [2]
Politische Einordnung
Unbhängig davon, ob F. Einzeltäter war oder nicht: Die Taten müssen im Kontext des politischen Klimas der 1980er und 90er betrachtet werden. Denn die Bombenanschläge wären nicht denkbar ohne das politische Klima dieser Zeit, das geprägt war von rassistischer Stimmungsmache und Gewalt. In den frühen Neunzigern hielt die neonazistische VAPO Gottfried Küssels Wehrsportübungen ab, die Szene rüstete sich für den Kampf. 1992 wurde eine Geflüchtetenunterkunft von Neonazis in Brand gesteckt, im gleichen Jahr wurde der jüdische Friedhof in Eisenstadt geschändet. Auch die parlamentarische Rechte erlebte einen Wandel: Die FPÖ entwickelte sich unter Obmann Haider rasant in Richtung rechten Rand, mit dem „Österreich-Zuerst-Volksbegehren“ verließen auch die letzten halbwegs liberalen Mitglieder die Partei und die FPÖ wurde zu dem, was sie heute ist: eine rechtsextreme Partei. Mit dieser öffentlichen Radikalisierung der FPÖ wurden auf einmal Dinge sagbar gemacht, die seit 1945 zumindest nur hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen werden konnten: Rassistische, antiziganistische und antisemitische Einstellungen konnten wieder offen geäußert werden. Und eine Gesellschaft, in der solche Einstellungen toleriert und schlussendlich belohnt werden, macht sich mitverantwortlich für die gewaltvollen Taten, die auf die verbale Hetze folgen.
Der Extremismusexperte Andreas Peham sagt: „Ein ‚Einzeltäter‘ begeht die Tat im Glauben, nicht allein zu sein – bei Anders Breivik waren es ‚die Tempelritter‘, bei Fuchs die ‚Bajuwarische Befreiungsarmee‘. Diese Taten wären ohne ihr ideologisches Umfeld nicht vorstellbar.“[3] Bis heute gilt der verurteilte Terrorist als verrücktes Genie, als durchgeknallter Einzelgänger, als psychisch Kranker. Die extrem rechte Ideologie, die hinter dem Terror steckt und der politische Kontext, in welchem die Terrorserien zu betrachten sind, wurden und werden in der Debatte meist ignoriert.
Hausdurchsuchung statt Krisenintervention.
Ein großer Teil der österreichischen Medien und Öffentlichkeit deutete die Gewalt damals rassistisch um. Das lag ohne Zweifel auch am Umgang der offiziellen Politik mit den Terroranschlägen. Am heftigsten zeigte sich das nach dem Vierfachmord in Oberwart: Das SPÖ-geführte Innenministerium äußerte sich zu dem tödlichen Bombenanschlag zunächst überhaupt nicht. Dann wurden zwei Theorien des Ministers veröffentlicht, wovon eine davon ausging, dass die vier Männer sich gegenseitig ermordet hätten. Die Polizei durchsuchte am Nachmittag des 5. Februar 1995 auf brutale Art alle 19 Wohnungen der Roma-Siedlung. Fünf Beamte pro Wohnung wühlten sich gleichzeitig durch die privaten Lebensräume der Menschen, deren Nachbarn, Freunde, Söhne, Brüder, Cousins, Enkel oder Ehemänner gerade direkt vor ihrer Haustür ermordet worden waren. [4] Tina Nardai war damals elf Jahre alt: „Sie haben alles auf den Kopf gestellt, unsere Schultaschen ausgeschüttet, alles mitgenommen, was ihnen handwerklich relevant erschien. Ich weiß nicht, ob sich jemand später offiziell entschuldigt hat. Keine Ahnung. Das war mein 5. Feber 1995.”[5] Psychomedizinische Versorgung erhielten die Angehörigen der Ermordeten keine: „Auf die Bedürfnisse der Hinterbliebenen der vier Todesopfer wurde zum damaligen Zeitpunkt keine Rücksicht genommen. Bei der Beerdigung waren sie alle schutzlos dem medialen und öffentlichen Interesse ausgesetzt. Psychosoziale Unterstützung oder therapeutische Hilfe erhielten wir nicht. Mit unserer Trauer, mit unserer Angst und mit unserer Wut mussten wir damals alleine fertig werden.“ berichtete Manuela Horvath auf einer Gedenkveranstaltung im März 2025. [6]
Interventionen der FPÖ
Die FPÖ, Haider und die österreichische rechtsextreme Szene bemühten sich darum, die Terrorserie und besonders das Attentat von Oberwart als linken Terror darzustellen, sowie die Opfer und
ihre Familien verantwortlich zu machen und zu diffamieren. So wurden von der FPÖ vehement Verbindungen zum Sprengstoff-attentat in Ebergassing hergestellt und verbreitet. Statt ordentlich zu ermitteln, war die Polizei mit dem Verfolgen falscher, von FPÖlern gelegten Fährten beschäftigt. [7] Den Ermordeten und ihren Familien wurden öffentlich illegale Aktivitäten unterstellt, sie wurden auf massive Art und Weise antiziganistisch beleidigt und diffamiert.
Rechtsextremer Terror: entpolitisiert und vergessen
Die meisten Österreicher*innen wissen besser Bescheid über die vermeintlichen psychischen Diagnosen des verurteilten Täters, als über die Empfänger*innen der Bomben und den politischen Charakter der Gewaltserie. Die Tatsache, dass die Erinnerung an rechten Terror den Täter in den Mittelpunkt stellt, gibt ihm noch mehr Macht und Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit für den Täter bedeutet auch Aufmerksamkeit für seine menschenverachtende Ideologie. Die Erinnerung an den Schmerz und die Angst der betroffenen Menschen, Familien und Minderheitengruppen wird gelebt von wenigen, in erster Linie von denen, die es direkt betrifft.
Die österreichische Mehrheitsbevölkerung erinnert sich heute an ein entpolitisiertes Gewaltverbrechen, begangen von einem angeblich geistig verwirrten Einzeltäter. Dass dieser Täter sich inhaltlich wie sprachlich völlig eindeutig auf die rechtsextreme und neonazistische Szene und Ideologie bezog, wird heute wie damals vergessen und ignoriert.
Bis heute hat sich für diese Terrorserie keine richtige Gedenkkultur entwickelt. Doch wir halten eine solche für unerlässlich!
Wir wollen deshalb dazu beitragen, dass sich in Österreich eine antifaschistische Gedenkpraxis etabliert; dass rechtsextreme Gewalt weder entpolitisiert noch bagatellisiert wird.
Und wir möchten, dass die Opfer und Betroffenen nicht vergessen werden. Dass ihre Namen erinnert werden, statt die Namen der Täter.
Für eine solidarische, antifaschistische Gedenkkultur!
Gegen das Vergessen!
Fußnoten
[1] eine gesammelte Auflistung aller Adressat*innen und Opfer befindet sich auf unserem Blog: initiativegedenken.noblogs.org/chronologie-des-terrors
[2] Vašek (1999): Ein Funke genügt, S. 286ff.
[4] Purtscheller (1998): Delikt: Antifaschismus, S. 26
[5] Nardai im Interview für die Ausstellung „Man will uns ans Leben. Bomben gegen Minderheiten 1993-1996″/Stimme Nr. 131, S. 28
[6] Die gesamte Rede befindet sich auf unserem Blog. Die Burgenlandromni ist die Cousine von Karl und Erwin Horvath. Sie leitet die Romapastoral der Diözese Eisenstadt und ist Hauptverantwortliche für die jährliche Gedenkfeier in Oberwart.
[7] Der FPÖ-Funktionär Martin Magdits gab sich bspw. gegenüber einem Siedlungsbewohner wiederholt als Ermittler aus und versuchte, ihn zu einer Falschaussage zu drängen. Nachzulesen etwa bei Purtscheller (1998)